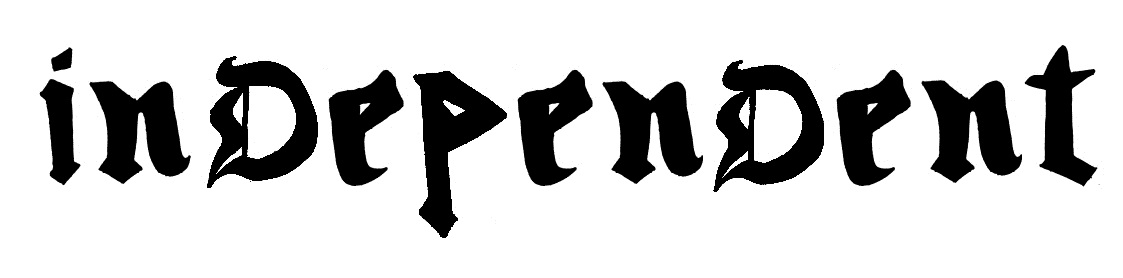Von verbranntem Brot und Eisen
Manchmal, wenn ich eine Tasse Tee durch meine Wohnung trage, bemerke ich sehr spät, wie heiß die Tasse zwischen meinen gespreizten Fingern ist. Die Information um die Hitze der Tasse braucht Zugang, um an mein Gehirn zu gelangen. Meine Fingerkuppen beginnen zu brennen, ich kann von einem Moment auf den anderen die Tasse nicht mehr halten. Will sie mit ihrem Inhalt fallen lassen und nur manchmal gelingt es mir, die Hitze und den miteingehenden Schmerz auszuhalten und die Tasse rechtzeitig abzustellen. So geht es mir auch mit Menschen. Die Hitze, das Feuer, welches sie ausstrahlen, bemerke ich erst, wenn ich selbst ein Teil davon bin und brenne.
Ich stehe in dem Garten meiner Großeltern, am abschließenden Ende bei den riesigen Zucchini und Tomaten. Meine Großmutter steht hinter mir, sie ist sehr klein und trägt ihre Hose immer bis unter ihren Brüsten, was sie ein bisschen so aussehen lässt als würde sie ohne Mittelteil existieren. Meine Großmutter wird nicht Oma genannt von niemandem von uns. Das kam uns und unseren Eltern, ihren Kindern gar nicht in den Sinn. Ich frage mich wieviel eigenen Anteil ich wohl bei der Entscheidung diese Person zu benennen getragen habe. Und wieviel dieser Name für mich meine Begegnung mit ihr seit meiner Geburt beeinflusst hat. Meine Großmutter bestaunt die riesigen Zucchini, die voll mit Wasser aufgesogen prächtig gedeiht sind. Sie kann sich für Dinge begeistern. Ich glaube, das habe ich von ihr. Nachher zum Abend essen wird es Kartoffelbrei geben, der neben Kartoffeln seine Geheimzutat Thunfisch beinhaltet. Wir werden kleine Mulden in die gelb weißen Berge bohren und sie mit einer Tomatensoße überschütten, die Dank des Süßstoffs meines Großvaters mehr süß als salzig schmeckt. Gekocht wird das Ganze in zu kleinen Gusseisernen Töpfen. Nur so erlangt das Gericht, welches übersetzt Brot a la Thunfisch heißt sein ganzes Geschmackserlebnis.
Ich bin seit ein paar Tagen in das Haus meiner Großeltern eingezogen. Um von meiner brennenden Tasse Abstand zu nehmen. Mein Handy habe ich am ersten Tag in die Holzschublade neben mein Bett gepackt. Mittlerweile denke ich nur noch etwa fünfmal am Tag an die süßen Dopaminstößeaufkommender Nachrichten. Mir sind seit meiner Tassenflucht einige Dinge aufgefallen, die ich mit meinem kleinen blinkenden Begleiter nicht realisiert hätte. Die Welt kommt mir so viel bunter vor. Ich schwebe andächtig durch das Leben und fühle mich wie eine Pionierin. Jede Blume starre ich verzückt an und ich ertappe mich sogar dabei an ihren Blüten zu schnuppern. Ach, muss meine Kindheit ohne Social Media schön gewesen sein. Allerdings bringt der Detox auch einige Nachteile mit sich. Ohne das ständige Beschallen meiner Ohren mit Podcasts, Musik oder Sprachnachrichten bin ich nun manchmal ganz schön alleine mit meinen Gedanken. Es kommt mir vor, als würde mein Kopf gar nicht wissen welche Anteile zu mir und welche zu meinem sonst immer ablaufendem Soundtrack in meinem Kopf gehören. Ich übe mich also in Geduld und versuche die Dinge, welche in meinem hinteren Kopf herumspuken, nach vorne zu holen und richtig eingeordnet wieder in meinen Hinterkopf zu verbannen.
Am Nachmittag steht Pilze sammeln an. Bewaffnet mit kleinen Körben spazieren wir zu Dritt in den angrenzenden Wald und suchen den sehr trockenen Boden nach essbaren Schwammerln ab. Auch da bemerke ich meine wachsende Ungeduld. Während meine Großeltern sich langsam durch das Dickicht bewegen, kann ich gar nicht schnell genug zum Ziel kommen. Mein Herzschlag wird schneller und meine Beine beginnen vor Anspannung zu kribbeln. Wenn wir nichts gefunden haben, was laut meinem Großvater am fehlenden Regen der letzten Wochen liegt, womit er Recht hat, fluche ich den ganzen Heimweg leise vor mich hin. Kein Dopamin in Form von Lob für meine guten Augen von meinem Großvater. Im Gegensatz zu meiner Großmutter ist mein Großvater mit seinem Hut, den er bei Wind und Wetter trägt, noch einige Zentimeter größer als ich. Ich erinnere mich noch wie gestern daran, als mein ältester Cousin die Größe meiner Großmutter erreichte. An diesem Abend überreichte ich ihm feierlich den umschwärmten Kaffeejoghurt, den nur die Erwachsenen essen durften und seine Kindheit endete.
Nach unserem Brot a la Thunfisch, schneidet mein Großvater noch ein paar Äpfel auf und beträufelt sie mit Süßstoff. Nachspeise. Das Abendprogramm bezieht sich ungewohnter weise nicht auf Beschallung durch Netflix, Handy und telefonieren gleichzeitig. In diesem Haus sitze ich stundenlang andächtig vor alten Pumuckl Schallplatten oder höre mir die Geschichte meiner Großeltern, an die ich immer und immer wieder hören muss, um sie niemals zu vergessen. Unsere Abendroutine endet damit, dass die Beiden in ihre getrennten Schlafzimmer verschwinden, nicht ohne sich einen Gute Nacht Kuss zu geben, was mich jedes Mal aufs Neue rührt und in mir eine Sehnsucht nach stabiler Liebe hervorruft.
Abends im Bett frage ich mich dann häufig, ob ich jemals die ganze Person meiner Großmutter oder meines Großvaters erfasst habe. Ich bin auf die Welt gekommen mit dem Selbstverständnis sie zu kennen. Dabei waren sie es die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben. Ich grübele dann darüber für wie viele nicht genannte Menschen meine Großeltern brennende Tassen gewesen waren. Und es vielleicht immer noch sind.
Der Morgen beginnt mit verbranntem Brot, weil mein Großvater es so am Liebsten ist. Für meine Großmutter ist das in Ordnung. Ich betrachte es, obwohl ich das schon mein ganzes Leben beobachtet habe mit einer Mischung aus Faszination und Ungläubigkeit. Ich möchte nach wie vor, dass er sein Brot nicht verbrennt, weise ihn auf das Krebsrisiko hin. Möchte diese Eigenschaft an ihm verändern und scheitere vielleicht gerade deshalb häufig hoffnungslos an brennenden Tassen.
Meine Großmutter begrüßt mit dem neuen Tag einen kleinen Esel, der sich auf der Wiese hinter ihrem Garten befindet. Er steht da, zwischen den größeren Pferden ganz selbstverständlich und freut sich über die Worte meiner Großmutter. Sie hat die Gabe mit ihrem Wesen alles und jeden zu verzaubern. Meine Großmutter fühlt sich an wie ein immer passendes Pflaster, das all die Wunden des Lebens für einen Moment verheilen lässt.
Ich kann mich nicht von dem Neid frei machen ebenfalls diese Wirkung auf andere Menschen haben zu wollen. Es gibt meines Erachtens niemanden, der meine Großmutter nicht mag. Ich glaube ihr Geheimnis ist, neben ihres durch ihre Geburt erworbenen gütigen Aussehens ,ihre Offenheit. Dabei hat sie in ihrer Kindheit durch die Deportation ihres Vaters schreckliche Dinge erlebt. Ich bestaune sie und frage mich ob sich ihre Gene irgendwann bei mir durchsetzen. Immerhin sind wir am gleichen Tag geboren.
In ein paar Tagen endet meine selbstgewählte Auszeit, meine Reise in meine Kindheit bei meinen Großeltern. Das kleine Ich in mir verbirgt eine ungeahnte Naivität und Zuversicht, zu der ich in meinem Alltag wohl mal wieder öfter Zugang schaffen sollte. Ich muss zurück zu meiner hoffentlich abgekühlten Tasse, zurück in mein Erwachsenes Ich und kann mich nicht mehr im Rücken meiner Großeltern und ihrem Trost verstecken. Ich muss zwar mein Handy mitnehmen, aber kann es ausgeschaltet lassen, solange ich will. Und vielleicht finde ich zwischen den Häusern in der großen Stadt einen kleinen Esel, mit dem ich mich unterhalten will oder ein paar Pilze am Wegrand. Und wenn gar nichts hilft verbrenne ich eben mein Brot.
Dämmerung
Die Frau bewegt sich in ihrer Küche. Ihr braunes Haar hat sie zu einem lockeren Knoten hochgesteckt, sie trägt einen Schlafanzug aus Seide und ihre Hände wählen präzise die nächsten Griffe aus. Wasserkocher an, Teebeutel aus der Verpackung nehmen, Mülleimer aufmachen, Teebeutel in die Tasse geben. Das dampfende Wasser aufgießen. Den Becher in die Hand nehmen. Sie sieht nach oben. Unsere Blicke treffen sich für einen Moment. Ich senke verlegen den Kopf. Zu lange schon stehe ich hier und starre in das Haus gegenüber, um es zufällig wirken zu lassen. Den Namen des Paares, welches in dem zweistöckigen Penthouse wohnt, kenne ich nicht. Der Bau wirkt mit seiner modernen Architektur etwas unbeholfen zwischen den prunkvollen Altbauten. Seit Monaten beobachte ich die Gewohnheiten der Beiden. Suche in ihrem Alltag Fragmente von mir. Er ist etwa vierzig Jahre alt, früh ergraut. Sie schätze ich etwas älter, schön geblieben. Oder noch schöner geworden. Der Glanz, den sie trägt, wirkt frisch. Wenn ich bei ihm bin unterhalten wir uns oft über die Beiden und spinnen uns ihre Geschichte zusammen.
Auf dem abgestandenen Tee hat sich eine bunt flirrende Schicht gelegt. Der Beutel klebt am Rand. Abgekühlt schmeckt das Getränk süß und falsch. Rahel drückt sich von der Couch hoch, zieht die hängenden Schultern an und hebt den Blick. Die Seide schmiegt sich an ihren verschwitzten Körper wie eine zweite Haut. Schon wieder auf der Couch eingeschlafen denkt sie. Ein Blick auf die Uhr verrät die Uhrzeit: Sie hat den Termin mit ihrer Patientin verpasst. Chloe, ein dünnes, blasses Mädchen mit mehr Angststörungen als der ICD10 hergibt. Früher wäre ihr das nie passiert, denkt sie. Ihre Patient*innen waren ihr ein und alles, sie erschien eher zu früh zu den Sprechstunden und zog sie absichtlich in die Länge. Mit dem Alter kam die Vergesslichkeit. Und die Müdigkeit. Rahel öffnet die Tür und tritt hinaus an die frische Luft. Ihr Blick sucht das gegenüberliegende Haus nach den beiden jungen Menschen ab, die ihr in letzter Zeit ihren Alltag versüßen. Junge Liebe. So unberechenbar und leidenschaftlich. Die beiden etwa 20-Jährigen lassen sie auch heute nicht im Stich. Der junge Mann lehnt sich aus dem geöffneten Fenster. Er wirkt wütend und aufgelöst. Sein Gesichtsausdruck hat etwas fassungsloses. Von ihr sieht sie nur das blonde auf und ab wippende Haar, als würde sie immer wieder durch das Zimmer stürmen. Worum geht es heute? Rahel zieht sich ihren Cardigan enger in ihrem Körper und streckt sich nach vorne, um den Wind ein paar Satzfetzen an ihre Ohren bringen zu lassen.
„Gelogen, vertrauen, kaputt“ sind die Worte, die sie trotz Distanz erkennen kann. Seine Stimme dröhnt, sie klingt laut, wütend aber vor allem verletzt. Rahel beugt sich weiter nach vorne, schirmt die Augen ab, um zu sehen was er in seiner Hand hält, weit von sich gestreckt. Papier. Mehre Blätter, die halb zerknüllt in seinen Händen hängen. „Alles kaputt“, wiederholt er nur.
Ich drücke mich von dem Spiegel weg und bewege mich auf das Bett zu. Automatisch streckt er die Arme nach mir aus. Mein Körper wird weich und etwas in mir beginnt zu ziehen. Seine Lippen streifen meinen Arm, seine Zunge fährt langsam über meine heißer werdende Haut. Ich ziehe ihm das T-Shirt über den Kopf, küsse sein Schlüsselbein, lege meinen Kopf in die weiche Halsbeuge. Er schmeckt nach Rauch und wir sollten das jetzt auf keinen Fall tun, denke ich noch.
Gerade noch hatten wir uns gestritten. Wieder einmal. Gehörte das zu Liebe dazu? Dieses Gefühl in mir, dass wir nie genug füreinander waren. Und dann wieder viel zu viel. Dieses ewige Pochen in meiner Brust. Der letzte Streit war anders gewesen. Endgültiger. Ich hatte versucht meine Gefühle auf Papier zu bringen. Er hatte sie gefunden. Doch keines meiner Worte wurde unserer Geschichte gerecht. Keines meiner kläglichen Versuche konserviert die Gefühle. Sie wurden gesprochen, kommuniziert haben geöffnete Münder verlassen und wurden durch die Schallwellen an Ohren getragen. Wir haben gesprochen, tagelang, nächtelang. Um immer und immer wieder zum selben Schluss zu kommen. Wir waren von Anfang an eine Geschichte, haben uns selbst in das Bühnenlicht gezerrt unter gleißendem Scheinwerferlicht unsere Probleme besprochen. Verdammte Worte. Verdammte Geschichte.
Rahel seufzt. Die beiden haben sich in eine Ecke des Zimmers verzogen die sich nicht sehen kann. Du alte Voyeuristin denkt sie. Der Schlüssel in der Haustür dreht sich und sie strafft ihre Schultern. Ihr Ehemann Jo schlendert auf sie zu, in der Hand hält er eine Plastiktüte dessen Inhalt Rahel als Essen identifizieren kann. „Beobachtest du wieder das junge Pärchen?“, fragt er und streicht ihr mit der freien Hand beiläufig die Wange. „Ich bin mir nicht sicher ob sie wirklich ein Paar sind“, erklärt Rahel. Jo tritt ans Fenster und starrt in die Dämmerung. „Ich denke schon“, er grinst. Rahel wirft einen flüchtigen Blick rüber. Das Mädchen öffnet das Fenster. Sie nur eine Decke über ihren Schultern und das umständliche Hantieren am Fenstergriff lässt auf ihre Nacktheit schließen. „Denkst du sie spiegeln unser junges Wir?“, Rahel wendet sich Jo zu. „Die beiden sind ständig in Diskussion, im Austausch. Sie wirken so lebendig. Und prüfen immer und immer wieder ihre Liebe.“ „Liebe ist eine Entscheidung“, zitiert Jo seine Frau. „Vielleicht sind sie sich noch nicht sicher, wie sie sich entscheiden sollen. Oder die Entscheidung steht, aber es ist noch zu schmerzhaft sie zu leben.“ „Ist Liebe wirklich eine Entscheidung? Oder ist es nur das Zulassen eines Gefühls, für das wir uns entscheiden?“, denkt Rahel.
Ich laufe durch das Treppenhaus auf den Fahrstuhl zu. Sein nachgerufenes „Bis Bald.“ enthält unsere Endlichkeit. Manchmal treffen wir Menschen in unserem Leben die in kürzester Zeit zu unserem Kern vordringen. Sich mit ihren Fingern durch unsere Haut, unser Fleisch bis an unser Inneres vorbohren. Menschen, von denen wir unser ganzes Leben nicht loskommen können, weil sie etwas in uns berührt haben. Sie hallen in uns nach, beeinträchtigen Tag für Tag unsere Entscheidungen unser Leben, auch wenn wir sie vermeintlich bereits haben gehen lassen. Als wir uns vor einigen Monaten kennengelernt hatten, hatte ich das Gefühl gehabt, dass er in den gleichen Farben wie ich sprach. Er hatte etwas Klares, Kühles und zugleich Warmes an sich wie das kurze Licht der Dämmerung. Das Licht des Tages welches zwischen Tag und Nacht schwebt. Nuancen in denen auch ich mich bewege. Der Fahrstuhl kommt. Ich steige ein und lehne meinen Kopf gegen den Spiegel. Bevor sich die Türen schließen tritt eine andere Frau in den engen Raum. Die Nachbarin von gegenüber. Wir sehen uns an. Ihre Lippen umspielt ein wissendes Lächeln, in ihren Augen sehe ich etwas was ich noch nicht deuten kann. Der Fahrstuhl hält an und wir steigen aus.
Alleinsein
Alleinsein. All-eins-sein. Das Wort bohrte sich in meine Haut. Sie fuhr mit einer feinen Nadel die Konturen entlang. Als würde sich so seine Bedeutung entfalten. Als würde es sich durch meine erste Hautschicht seinen Weg bis in mein Herz bahnen. Als würde ich es verinnerlichen. Du musst mal alleine bleiben. Die Worte meiner Freund*innen bohrten sich mindestens genauso tief in mein Inneres wie die schwarze Tinte, mit der die Frau vor mir, mit ihren blonden kurzen Haaren, ein kleines für immer Kunstwerk auf meine Haut zeichnete. Ich stand mit leicht wackeligen Knien auf. Es war nicht mein erstes Tattoo. Genau wie der Rest meiner originellen Generation hatte ich mir kleine Erinnerungen auf die Haut bannen lassen. Da war ein Fisch. Ein regnerischer Tag in Barcelona, die Sagrada Familia die wir auf keinen Fall besucht hatten und der kleine Laden, der uns mit Freundschaftspreisen lockte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Freundschaftstattoo auf unsere ersten gemeinsamen sechs Monate, eingekuschelt zwischen dicken Decken, geflüsterten Geheimnissen und unsere gemeinsame Ewigkeit am Knöchel. Die anderen Tattoos trugen ihre Bedeutung in einer Selbstverständlichkeit nach außen. Ein kleines Herz, gestochen von einer Freundin, mein Sternzeichen und eine Feder. Und nun Alleinsein. Substantiv. Neutrum. Ein Wort dessen Bedeutung sich erst bei genauem Hinsehen entfaltet. Ich hatte das Wort immer mit seiner schweren, dunklen Schwester der Einsamkeit verbunden. Und ich hatte Angst davor einsam zu sein. Nachts wenn ich wach lag, schlich sie sich neben mich und stupste mich mit kalten Fingern an, um mich aus dem Halbschlaf zu reißen. Ich brauchte dann erst einmal ganz viel Luft, um mich zu erholen, ganz viel meditatives Atmen und einen grauen Elefanten, um den ich meine Arme schlingen konnte. Kein Buch hat mich so sehr geprägt wie Benedict Wells „Vom Ende der Einsamkeit“, in dem es um Verlust ging und die Frage was wohl für immer in uns blieb auch wenn sich alles änderte.
Ich trat auf die Straße mit meinem neuen Tattoo, meiner kleinen Botschaft an mich. Das Alleinsein zu zelebrieren, die Zeit für mich zu nutzen in der ich nur bei mir war. Der Einsamkeit den Kampf anzusagen. Das Abendlicht der Stadt warf Schatten an die Wände der Häuser um mich. In dem Moment war es so als würde ich den letzten Sommer noch einmal erleben. Nur ohne die Zerrissenheit. Der schale Geschmack von zu lang gelebten Erinnerungen legte sich in meinen Mund. Die Hände der Anderen hatten seine Spuren verwischt, hatten die Teile von ihm die auf mir lagen mitgenommen. Hatten mir das Alleinsein erträglich gemacht, die Einsamkeit mit ihren Mündern von meinem Körper verscheucht. Ich wusste, dass das nur temporär war, dass ich anfangen musste in mich selbst hineinzublicken. Immer wieder aushalten. Der Umzug in die neue, viel größere Stadt bedeutete ein Neuanfang. Kisten in der Altbauwohnung auspacken und die ersten Nächte auf einem kalten Boden verbringen. Der Abschied von der alten Stadt zog sich klebrig süß über lange Sommernächte auf Dächern, in denen wir uns aus Büchern vorlasen und uns in den Worten wiederfanden. Die Frage 'Wie wird wohl alles in einem Jahr sein?', lag wie ein stummer Begleiter in jedem unserer Gespräche. Wir hatten alle Angst davor unsere sichere Oase zu verlassen, in der wir immer und immer wieder uns hatten. Hatten Angst davor, zu wem uns die neuen Städte wohl machen würde. Im Nachhinein kam mir die Angst unbegründet vor. Nach ein paar Monaten in der neuen Stadt war ich irgendwie immer noch die Gleiche. Ich hatte sehr schnell gelernt, dass sich die Vertrautheit auf neuen Gesichtern nach kurzer Zeit einstellen konnte. Und dass Zuhause ein dehnbarer Begriff war, der nun seine Schnüre über verschiedene Städte zog in denen Menschen wohnten, die ein Stück von mir in sich trugen. Immer wenn ich in einer dieser Städte zurückging, brauchte ich einen Moment, um es mir in den anderen Menschen gemütlich zu machen.
Ich verscheuchte meine Gedanken, die durch die Schatten auf der Hauswand aufgekommen waren. Und freute mich auf den Abend. Für den Abend war Kochen geplant. Der Abend versprach leicht zu werden. Süß wie die zitronige Sauce die wir über unsere Nudeln kippten. Ich lächelte und sprach mit einem Glas Weißwein in der Hand. Fühlte mich wohl und angekommen. Als hätte sich die neue Stadt an diesem Abend um mich geschmiegt. Ich realisierte nicht einmal, dass sich die Tür hinter mir öffnete. Haselnussbraun. Und strubbeliges blond. Vielleicht waren das meine ersten Assoziationen. Und dann grüne Farbtupfer und goldenes Braun. Eine Farbexplosion als unsere Augen aufeinandertrafen. Etwas in mir veränderte sich in diesem Moment. Nur dass ich es noch nicht wusste. Zwischen mehr oder weniger fremden Menschen und schalem Alkohol saß ich einige Stunden auf dem Boden der Altbauwohnung und spielte ein Trinkspiel. Wir betranken uns in belanglosen Gesprächen und fühlten diese süße Leichtigkeit sich jung und frei zu fühlen. Als ich später im Club tanzte fühlte sich alles nach fliegen an. Er stand neben mir. Griff nach meiner Hand. Ich lehnte meinen Kopf an seine Schultern und schluckte kurz, weil sein Geruch mich aus der Bahn warf. Ich assoziierte etwas damit. Geborgenheit. Vertrautheit. Dann drehte ich mich um, schüttelte ihn, den dampfenden Club und das Gefühl ab und trat in die kalte Nachtluft. Ich hob mein Handgelenk und sah das kleine geschwungene Wort. Alleins-sein.
Von Büchern und Lichtschatten
Die Luft roch nach verschwommener Konzentration. Nach Trauer, Wut und Resignation. Nach Verzweiflung und Zedernholz. Ein penetranter schwerer Duft, der meine Gedanken zu ersticken drohte. „Dritter Stock“ hatte die, sogar durch die knarzende Gegensprechanalage sanft wirkende Stimme gesagt. Also gut, drei Stockwerke zu bewältigen. Den ersten Stock hatte ich soeben geschafft. Hässliche graue Steintreppen und ein dunkler Gang. Der zweite Stock war heller, seltsam modern in diesem Haus. Als hätte der Architekt wie bei einem Pick Up eine harte süße Schokoladenschicht dazwischen gepresst. Von dem dritten Stock trennte mich eine Glastür mit einem Schlüssel. Gebogene Treppenstufen, die sich verführerisch rankten und mir Eintritt gewährten. An ihrem Ende stand sie. Mit unerschütterlich klarem Blick. Blaue Augen, weiße Haare, die sie in einem lockeren Pferdeschwanz gebunden hatte. Sie wirkte unglaublich jung und so alt zugleich. Ich folgte ihr in den Raum am Ende der Wohnung. Ein brauner knarzender Holzboden, dessen Schwielen die Geheimnisse der Menschen aufsogen und sorgfältig verstauten. Dazu, überall Pflanzen. Große und Kleine, die die Luft filterten und wie es mir schien, neugierig ihre Köpfe reckten. Aber vielleicht hatte ich mir das nur eingebildet. Zwei Sessel, ein Tisch und Teppiche. Ich stand etwas verloren vor den Stühlen und versuchte mich zu entscheiden, auf welchem ich die nächsten Wochen mein Herz ausschütten wollte. „Warum sind sie hier?“ fragte sie als ich mich endlich niedergelassen hatte, auf dem Stuhl weg vom Fenster, Richtung Tür. Vielleicht hatte ich ihn unbewusst gewählt, um fliehen zu können, wenn ich Gefahr witterte. „Wegen der Bücher“ sagte ich. „Wegen all der Büchern die ich niemals lesen kann. Weil es zu viele sind. Und wenn ich sie nicht lese wird es abreißen.“ Sie sah nicht einmal verwirrt aus bei meiner Antwort. Dabei verstand ich sie selbst nicht. Warum redete ich denn jetzt von Büchern? „Mein Vater legt mir immer Bücher auf den Schreibtisch, wenn ich bei ihm bin. Jedes Mal, wenn ich nach Monaten heimkomme, stapeln sich die Bücher. Ich schaue sie mir dann an. Stehe vor ihnen rum und streiche mit meinen Händen über die Seiten. In diesem Moment bedeuten sie mir immer die Welt. Verstehen Sie?“ Sie nickt. „Und warum sind Sie jetzt hier?“ Ich hob den Kopf und sah sie direkt an. Musterte sie, betrachte jede kleine Falte, jeden kleinen Fleck auf ihrer Haut, brannte mir ihre Mundwinkel ein, die leicht gehoben waren. „Weil es diesen Tag gab. An dem alles anders wurde. So viel besser und so viel schlimmer zugleich. Zu viel zu ertragen für einen Tag.“ Sie schüttete mir etwas Tee in ein kleines buntes Glas dessen Muster Schatten warfen. Er schmeckte süß und klebrig. „Und dann gab es nicht nur einen von diesen Tagen, sondern immer mehr.“ Sie sah mich an. Ruhig und gelassen und unglaublich zuversichtlich. „Erzählen Sie mir von einem Tag,“ sagte sie dann. „Lassen Sie keine Gefühle aus“ Ich dachte nach, dann begann ich zu sprechen:
Es ist die tiefste Privatheit und tiefste Verwundung, die sich in diesen Worten offenbart. Ich saß auf dem Boden im Badezimmer. Weiße Fließen, moderne gebogene Waschbecken und ein Spiegel. Mein Gesicht sah seltsam verzerrt aus, meinen Kopf hatte ich gegen die Badewanne gelegt. Sie standen vor der Tür. Klopften und versuchten mich mit Stimmen zu besänftigen. Ich konnte die Lichtfetzen in meinem Kopf nicht unterscheiden. Sah uns durch die Stadt tanzen, auch wenn es regnete. Sah uns wegen der Essensfrage streiten und um den runden Holztisch sitzen. Wir hatten geredet an diesem Abend und dann gestritten. Bis ich aufgestanden war. Die Holztreppen nach unten rannte und in die kühle werdende Sommerluft trat. Nach meinem Handy angelte und nach Luft schnappe. Das hier war mein Showdown. Vorhang auf. Applaus für mich und all die Momente, die ich vor mir und ihnen verschwiegen hatte. Wir waren schon immer befreundet gewesen, zumindest einige von uns, eigentlich seitdem ich denken kann. Hatten zusammen die Jugend bestritten. Uns verband das Gefühl unzertrennbar zu sein. Dabei hattet es nur verschiedene Studienstädte gebraucht, um ein kleines Loch zwischen uns zu reißen, das sich nun immer mehr ausdehnte. Deswegen hatten wir diese Auszeit gebucht. Einige Tage weg, raus in eine andere Stadt. Und nun stand ich hier. Mit dem Wissen, verletzt zu haben. Mal wieder. Ich hatte sie ausgeschlossen aus meinem Leben. Ihnen all das nicht erzählt, was die letzten Monate ausgemacht hatte. Was mich nächtelang wachhielt, mir den Atem nahm und gleichzeitig so viel Luft gab. Ich lief durch die dunkle Großstadt. Beobachtete die Lichter des Kanals, die sich auf dem Wasser spiegelten. Sah den fremden Menschen ins Gesicht, besah mir die Intimität der Anonymität. Vielleicht erwartete ich, dass mir eine von ihnen nachlief. Sich um mich sorgte. Aber die Nacht verschluckte mich und ich begriff, dass nur ich die Dinge ändern konnte. Die Dunkelheit in meinem Kopf, mit der ich mich angefreundet hatte, gehörte nur mir. Aber ich musste ihr keinen Platz geben. Unsere Freundschaft hatte sich nicht verändert, weil mir keine von ihnen nachlief. Unsere Freundschaft hatte sich verändert, weil in meinem Kopf die Dunkelheit den ganzen Platz eingenommen hatte und ihnen den Raum genommen hatte. Ich hatte nur genommen, hatte erwartet, dass sie geben würden, ohne ein Stück von mir zu nehmen. Das war der Moment, in dem ich verstand. In dem alles so viel besser wurde. „Das war der Moment, in dem ich begriff, dass ich zu ihnen muss“, sagte ich und sah die Frau an, die mir gegenübersaß.
Einer dieser perfekten Tage
Es war einer dieser perfekten Tage. Einer dieser Tage, die für immer blieben. Einer dieser Tage über dessen Datum man im Rückblick immer wieder streichen möchte. Um so vielleicht noch einmal zurückzukommen. Und sich noch einmal so zu fühlen. Über unserem Kopf schwebte unsere Seifenblase. Sie glitzerte in ihrem vollkommenen grünblau. Hielt ihre perfekte Balance, war nicht zu klein, sodass sie schrumpeln und verpuffen konnte als hätte es sie nicht gegeben. Und sie war auch nicht zu groß, um mit einem lauten Knall unsere Idylle zu zerstören. Sie hielt ihr Gleichgewicht, schien dabei sogar mühelos zu tanzen. Die Sonne knallte an diesem Tag schon vormittags mit 25 Grad auf unsere Euphorie runter. Viel zu warm für Juni, aber wir begrüßten das Wetter mit knapper Kleidung und der Sonne entgegengestreckten Gesichtern. Ich tänzelte schon den ganzen Morgen. Lief immerzu auf Zehenspitzen, streckte meine Beine durch und machte mich ganz lang. Keine Ahnung, warum ich das tat. Es erschien mir passend an einem solchen Tag. Emily saß im Schneidersitz auf dem Boden, ihr Gesicht mit einer Kappe bedeckt, um ihre sehr helle Haut zu schützen. Verbarg damit ein wenig die Chance auf Sommersprossen, die auf ihr Gesicht kletterten und es sich gemütlich machten. Für eine Saison, um dann wieder lautlos zu verschwinden, wenn der Herbst kam. Kleine Reisende für eine schöne Zeit und einen kurzen schmerzlosen Abschied. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Mayla stand neben ihr, eine Musikbox in der Hand und so kitschig das jetzt klingen mag, sie bestimmte in dem Moment über den Soundtrack unseres Sommers. Wählte Musik aus, die für immer in unseren Köpfen hängen blieb. „Berlin Offline“ von Benjamin Amaru und Wolfskind dröhnte etwas zu laut aus den Lautsprechern. „Lass uns losfahren“, drängelte sie. Und das taten wir. Wir quetschten uns, unsere vollgepackten Taschen und eine Kühltasche in mein Auto. Ich überließ Emily das Fahren und saß hinten, mit angewinkelten Beinen und stickiger Luft. Drei, das ist eine zu viel. Drei, das geht nicht gut. Jemand wird sich immer ausgeschlossen fühlen. Über diese Sätze dachte ich nach, als ich so dasaß, hinten, in der Mitte. Drei ist eine Gruppe. Und Gruppendynamiken veränderten sich ständig, waren mal einfacher, mal schwieriger. Sie waren verstrickt und alle Mitglieder mussten bereit sein, Kompromisse einzugehen. Das war nun mal einfach so. Momentan saß ich hinten, nahm die Kinderposition ein. Aber es hatte Zeiten gegeben da war ich am Steuer oder auf dem Beifahrersitz gesessen. Mein jetziger Platz kam mir noch ungewohnt vor. Neu. Der Gurt saß etwas zu eng und der Sitz war kalt. Aber ich würde mich schon noch daran gewöhnen. Und durch diese Sicht hatte ich sie beide im Blick. Ich konnte sehen wie Emily mit ihrer Hand nach den Gummibärchen angelte, die in der Mittelkonsole lagen und wie Mayla mit einem Lächeln auf ihr Handy tippte.
Der Weg zu dem Haus war steil und Emily würgte zweimal fast den Motor ab, was ein unruhiges fast panisches Kribbeln im Bauch auslöste. Und Erinnerungen. Verschwommene Bilder. Doch als ich unsere Destination sah, vergaß ich alles um mich herum. Und mein Kribbeln im Bauch verwandelte sich in Glück. Das Haus hatte hellblaue Fensterläden und eine unverputzte Backsteinfassade. Es schmiegte sich an ein lichtes Waldstück, an der Vorderseite standen vereinzelte Holzstühle mit bunten Bezügen, eine Eisenbank mit verschnörkelten Seitenteilen und Kissen und ein niedriger Tisch. Ich sah uns hier schon sitzen, in Decken gewickelt mit Antipasti auf den Tellern und Aperitif Gläsern in der Hand. Dem Drang vor Vorfreude meine Hände anzuwinkeln und sie schnell an der Seite des Körpers zu bewegen widerstand ich. Ich hatte diese „Wegflieggeste“ wie sie in meiner Familie genannt wurde als Kind immer gemacht, wenn ich besonders aufgeregt, traurig oder glücklich war. Also eigentlich immer. Ich sei wohl mal in einem anderen Leben ein Vogel gewesen, war die Begründung meines Onkels. Mittlerweile unterdrückte ich den Impuls abheben zu wollen. Tippelte nur leicht mit den Füßen auf dem Boden. Das Beste an dem Haus war der angrenzende See. Blau. Na gut, eher schlammgrün, umringt von Schilf. Und eine Schaukel, die an der Weide hing und sich tief über den See beugte. Ein intimes Zusammenspiel. Dieser Anblick war vollkommen. Ich sah nach oben und sah unsere Seifenblase, die sich langsam im Wind wiegte.
Mayla, Emily und ich hatten diesen Ort stundenlang ausgesucht. Jede von uns hatte ihre Kriterien für eine Unterkunft in einen Topf geworfen, wir hatten diskutiert und sie gefunden: Unsere kleine Idylle für die nächsten zwei Wochen. Nach dem Abendessen, es gab Maylas berüchtigte vier-Käse-Spinat-Lasagne, die uns schon so einige verkaterte Morgen gerettet hatte und nur so vor Fett und guter Laune triefte, machten wir es uns auf der Terrasse gemütlich. Aus dem kleinen Schuppen neben dem Haus hatte Emily eine Hängematte gekramt, die sie umständlich auf der Terrasse befestigte. Sie lag nun darin eingekuschelt in ihre Decke und sah in die Sterne. Mayla und ich waren eingegraben in den bunten Kissen und Wolldecken auf der Bank.
„Meint ihr unser Leben wird jemals wieder so perfekt, wie jetzt gerade?“, durchbrach ich die Stille. „Ich meine wir werden nie wieder so jung und so frei sein. Wir stehen am Ende unseres ersten Studiums. Irgendwie ist uns alles offen. Es ist als würden wir vor hundert Türen stehen. Als würden wir gemeinsam in diesem Vorraum befinden und eine von uns läuft irgendwann los“
„Ich bin aber schlecht darin Entscheidungen zu treffen. Jedes Mal, wenn ich es dann doch mache, bereue ich es im selben Moment und möchte zurückgehen, eine andere Tür nehmen. Was wenn ich das irgendwann nicht mehr kann?“, fragte Mayla und ihre Stimme klang brüchig. „Was, wenn irgendwann jemand anderes für mich entscheidet und ich nur noch voran kann? Was wenn ich mich dann verlaufe?“
„Das wird nicht passieren!“, mischt sich Emily ein, „Klar, wird es Entscheidungen geben, die sich so verdammt falsch anfühlen, tage- oder sogar monatelang. Aber durch diese Dinge wirst du die nächsten bewusster und nachdenklicher treffen. Und dadurch entstehen so viel bessere Momente. Und du hast gelernt. Ich glaube, wir sind das ganze Leben damit beschäftigt uns zu fragen, wo wir noch hätten abbiegen können. Wo wir besser stehen geblieben wären oder lieber gerannt wären. Wo wir uns dann stattdessen jetzt befinden würden. Rückblickend muss ich aber sagen, meine Entscheidungen müssen größtenteils ziemlich gut gewesen sein“. Sie breitete die Arme aus. „Ich bin gerade in diesem Moment glücklich. Ich fühle mich irgendwie ganz. Versteht ihr was ich meine?“
Ich richtete mich ein wenig auf, um sie anzusehen. Betrachte ihr Gesicht das von den der Lichterkette warm erleuchtet wurde. „Ich verstehe, was du meinst“, sagte ich dann nach einigen Momenten des Zögerns. „Ich fühle mich in den absurdesten normalsten Momenten unvollkommen und leer. Das sind Momente, in denen die Sonne scheint, in denen ich vielleicht mit Freunden oder meiner Familie spazieren gehe. Momente, in denen ich vermeintlich zufrieden bin. Und dann plötzlich...von einem Moment auf den Anderen. Leere. Früher wurde ich panisch. Habe versucht mehr zu reden, um die Stille in mir zu füllen, bin albern geworden. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es vergeht. Dass dieses verdammte Loch in mir gefüllt wird. Ganz plötzlich. Es kann ein kurzer Ortswechsel sein. Ein in Licht getauchter Baum. Die Heimfahrt oder ein gutes Buch. Ich habe gelernt die Leere zu akzeptieren. Ihr ihren Platz zu gewähren. Weil ich weiß, dass sie wieder geht. Und es okay ist. Genau wie es okay Dinge zu entscheiden.“ ich wandte mich an Mayla. „Du weißt, wie schlecht ich darin bin. Dass ich sie nicht treffe, bis das Leben oder eine andere Person mir das abnimmt. Und dann muss ich mit der Entscheidung von jemand anderem leben. Das möchte ich nicht mehr“, fügte ich hinzu. Ich zoomte mich heraus. Blickte aus der Vogelperspektive auf uns hinunter. Sah uns drei hier liegen. Gemeinsam, aber jede mit eigenen Gedanken, eigenen Sorgen und Ängsten. Das hier war gut. Das hier war randvoll und überhaupt nicht leer. Mein Handy blinkte auf. Eine neue Nachricht. Ich las sie und in diesem Moment zerplatzte unsere schillernde Seifenblase an der Hauswand.
Eine Ahnung von Liebe
Ich lehnte meinen Kopf gegen das Autofenster, sah die Landschaft an mir vorbeiziehen. Betrachtete das Glitzern des Sees und die Umrisse der Berge im Hintergrund. Beides verschwamm und die Farben gingen ineinander über. Es erinnerte mich an ein abstraktes Bild, das meine Mutter einmal gemalt hatte als ich ein Kind war.
Ich versuchte das Bild einzufangen, den Moment zu speichern und vielleicht darauf zurückgreifen, wenn ich mich nicht so frei fühlte. Wenn das Grau des Alltags überwog und mich immer weiter runterzog.
Ich drehte meinen Kopf und sah ihn an, wie er dort saß. Die Hände lässig auf das Lenkrad gelehnt, der Kopf wippte im Takt der Musik und sein Mund lächelte.
Ich fragte mich, ob das Leben für solche Momente lebenswert war, ob genau das der Sinn war, nachdem wir alle so verzweifelt suchten. Jede Generation auf ihre unterschiedliche Art und Weise. Wenn das Leben eine Aneinanderreihung dieser Momente wäre, würden wir sie vermutlich nicht mehr wertschätzen, nicht merken, dass es genauso ein Moment war. Der Himmel färbte sich langsam rot, eine große dunkle Wolke schob sich vor als würde sie uns drohen wollen.
In meinem Kopf stand die Wolke symbolisch für den Alltag, der versuchte mich meiner Illusion zu berauben. Mir war es immer schwer gefallen glücklich zu sein, wenn die anderen Kinder lachten und spielten saß ich meist nachdenklich daneben und sah ihnen zu. Versuchte den Sinn zu finden und fragte mich immer wieder, warum es mir so schwer fiel mich fallen zu lassen und im Moment aufzugehen. Ich hatte Angst davor mich zu blamieren und, dass die Kinder über mich lachen könnten. Diese Eigenschaft verfolgte mich bis in mein Studentenalter. Auf Partys war ich still, versuchte nicht aufzufallen, hörte den Gesprächen zu und sehnte mich nach mehr Tiefe. Nach mehr Poesie, mehr echten Gedanken die mich spüren ließen lebendig zu sein.
Doch genau jetzt in diesem Moment, fühlte ich mich sehr lebendig neben ihm, alleine die Wärme seiner Haut zu spüren, ließ mich ruhig werden.
So viel Leichtigkeit hatte ich schon lange nicht mehr gespürt. Die letzten Wochen hatte ich damit verbracht desillusioniert auf meiner Fensterbank, in meinem kleinen und dafür viel zu überteuerten WG-Zimmer zu sitzen und auf meinen Laptop zu starren. Ich hatte einige Bewerbungen abgeschickt, halbherzig mit dem Wissen, dass es bessere gab als mich. Mit bunteren Lebensläufen, in der keine Lücke auf dem weißen Papier zu finden war. Sinnvoll genutzte Monate, voller Praktika und ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Und zwischendurch hatten diese Leute mal ganz eben sich selbst auf einer Bali Reise gefunden, was auch immer das heißen mochte. Wobei die CO2 Bilanz dieser Reise wohl heutzutage in roten Buchstaben stehen sollte.
Mich überforderten die vielen Möglichkeiten, die sich boten und anstatt anzufangen, vergrub ich mich in Selbstmitleid und fühlte mich wohl in meiner Rolle als Studentin ohne Plan.
Er hingegen wusste was er wollte, sein Leben war die nächsten Jahre geplant, er verfolgte ein Ziel und war ehrgeizig. Sein Alltag bestand aus Plänen: Trainingsplan, Essensplan, Lernplan, Putzplan. Wenn er keine Struktur hatte wurde er nervös, begann zu zappeln und seine Stirn zog tiefe Falten.
Wir hatten uns auf einer Party kennengelernt. Es war kalt und grau und ich hatte meine Wohnung nur verlassen, um ein paar Straßen weiter auf eine Hausparty zu gehen. Er kam später als die anderen, die Party war schon fast vorbei. Natürlich, denn er musste ja seinen Trainingsplan durchziehen, bevor er feiern gehen konnte. Ich saß auf der Couch, lässig ein Bier in der linken Hand und tippte mit der rechten auf meinem Handy herum, scrollte durch Instagram und sah mir die Profile der Menschen an, die sich hier befanden und die ich nicht kannte. Ich war nicht die Einzige in diesem Raum die das tat, anstatt sich zu unterhalten. Lieber erst einmal Sicherheit gewinnen und mit einem Handy in der Hand sah man lässig und selbstsicher aus. Einige andere spielten Bierpong als wären sie auf einer Olympiade, wieder andere bewegten sich zur Musik.
Ich sah auf als er den Raum betrat. Sein Blick wanderte durch den Raum, er scannte die Personen ab und überlegte wen er kannte. Seine Augen blieben eine Sekunde zu lang an meinen hängen als sich unsere Blicke trafen. Er sah aus als würde er sich unwohl fühlen, irgendwie nachdenklich.
Ich stand auf, leicht schwankend, weil meine zweite Flasche Bier sich wohl bemerkbar machte und steuerte auf ihn zu. Unser Gespräch entwickelte sich schleppend, meine Zunge war schwer vom Alkohol und mein Kopf vernebelt. Irgendwann zog er mich am Arm nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Wir liefen durch die dunkle, kalte Nacht und begannen zu sprechen. Es war als wäre in meinem Kopf ein Schalter umgelegt worden. Ich erzählte ihm Dinge die ich seit Jahren vor mir selbst verschwieg, bildete mir ein er könnte mich verstehen und mich halten. Er sprach von seinen Träumen, seinen Plänen etwas Großes zu erschaffen. Wir redeten aneinander vorbei, kamen auf keinen gleichen Nenner und waren prinzipiell unterschiedlicher Meinung. Aber uns war beiden klar, dass wir uns wieder sehen mussten auch wenn wir niemals zusammenfinden würden.
Und jetzt saßen wir hier, nach einigen Monaten in seinem Auto und fuhren Richtung Süden. Er hatte die Idee gehabt, dem Alltag zu entfliehen, einfach loszufahren. Ein Traum für meine romantische Ader. Wir hatten nicht darüber gesprochen, was das zwischen uns war. Immer wenn es um eine Definition ging, lenkte einer von uns beiden ab, beteuerte später nochmal darüber zu reden. Wir wussten beide, dass wir uns in einer Illusion, eines Gefühls verloren hatten. Keine Ahnung, ob das eine Ahnung von Liebe war. Auch wenn wir meistens in einem Gespräch von völlig unterschiedlichen Dingen redeten brauchten wir uns und taten uns gut.
Er versuchte mir einzureden, mehr an mich zu glauben und größer zu träumen. Ich versuchte ihm eine gewisse Tiefgründigkeit zu vermitteln.
Der Regen setzte ein als wir die Grenze nach Italien passierten, er trommelte auf das Autodach und hinterließ ein dumpfes Geräusch. Ich holte tief Luft und erzählte ihm, dass ich nach Berlin gehen würde. „Alle die in meinem Bereich studiert hatten gingen nach Berlin, da gab es mehr Möglichkeiten sich zu neu zu erfinden“, begründete ich meine Entscheidung. Er sah mich an und ich wusste in diesem Moment, dass unser „Lass später nochmal darüber reden was wir sind“ nicht ausreichen würde. Ich blinzelte die Tränen weg, die sich in meine Augen verirrt hatten und schüttelte leicht den Kopf. Setzte ein Lächeln auf und beschloss mich wieder in der Leichtigkeit des Moments zu verlieren. Ich sah, dass er das Selbe tat. Wir hatten uns genau in diesen Moment, was kümmerte uns was morgen war. In diesem Augenblick war die Leichtigkeit des Lebens unerträglich. Der Regen hörte auf und die Sonne kämpfte sich hinter den dunklen Wolken hervor. Ich lächelte und kurbelte das Fenster runter.